Une chose est certaine. L’année 2016 va entrer dans les annales comme «année des mutations». Elle nous a amené des actes terroristes, Brexit, des crises politiques en Italie et Espagne, des succès de l’extrême droite en France et Allemagne, Trump et une ambiance de crise à Bruxelles. Le monde s’est mis sens dessus dessous. L’Europe souffre d’instabilité. Plein d’évènements qui sèment l’incertitude dans notre quotidien. Notre avenir est de plus en plus précaire. 2016 est une année de mutation vers une ère nouvelle.
Il est difficile de trouver dans cet amas d’évènements obscurs un indice qui nous promet un bon avenir. Faux! L’année passée nous a aussi fourni des raisons d’espérer, dont un signal positif de taille mondiale: le projet SOLARIMPULS.

SOLARIMPULS, le projet d’avion suisse de Bertrand Piccard et André Borschberg. Ces deux pionniers de l’aviation ont réussi à faire le tour du monde sans une goutte de kérosène. Par un engin volant de l’envergure d’un Airbus et le poids d’une voiture Mondeo. En 17 étapes ils ont parcouru une distance de 42’500 km. Assis devant le manche à balai pendant un peu plus de 23 jours à la vitesse de 80 km/h tout juste. Ils n’ont pas cherché un record, des médailles et autres distinctions, mais de remplir une mission, de passer un message.
Le projet SOLARIMPULS comporte deux parties, le vol d’une part et les actions d’amélioration de l’exploitation d’énergie d’autre part.
Lors de son tour du monde précédent, non-stop en ballon, Bertrand Piccard avait atterri en Egypte en ayant épuisé presque totalement sa réserve de carburant. Il lui restait à peine 1% du gaz liquéfié au réservoir. C’était limite! Alors, l’idée lui est clairement apparue. Le prochain tour du monde devra se faire sans carburant. Cela doit pouvoir se réaliser sans carburant fossile. Les sources d’énergie charbon, pétrole et gaz naturel sont économiquement non rentables, techniquement dépassées et pas du tout écologiques.
Le temps est venu de remplacer le gaspillage de ces ressources par des énergies durables. Tel un éclair l’idée du projet SOLARIMPULS a jailli dans son esprit. Tourner autour du globe sans carburant fossile, entrainé uniquement par l’énergie solaire. Montrer à l’humanité que des solutions différentes existent.
C’était en 1999. Deux ans plus tard les études de faisabilité démarraient à l’école polytechnique de Lausanne. Après deux autres années, en novembre 2003, Piccard et Borschberg annoncèrent officiellement le lancement du projet. Il s’acheva provisoirement à la fin cette année 2016, à nouveau en novembre, lorsque l’appareil «SOLARIMPULS DEUX» fut retourné en pièces détachées à son aérodrome de départ de Dübendorf. Ainsi se termina la partie technique du projet.
Un projet gigantesque qui a duré 15 ans, occupait 60 personnes, coûtait 140 millions de francs suisses s’est réalisé avec succès.
Je cite Bernard Piccard après l’atterrissage: «Si un aéronef peut voler jour et nuit sans carburant, entrainé uniquement par l’énergie solaire, personne ne pourra désormais prétendre que de telles solutions ne soient pas réalisables pour des voitures, ordinateurs ou climatiseurs». Ainsi était diffusé le message pour le lancement d’énergies renouvelables comme p.ex. l’énergie solaire. Une mission traverse le monde.
Revenons à cet effort énorme d’esprit pionnier. Question: «Quelles sont les conditions essentielles nécessaires pour réaliser d’une telle entreprise?».
La volonté de franchir des obstacles impossibles.
La maîtrise de la conduite d’un projet à long terme.
Le courage d’aborder du terrain technique vierge par l’ingénierie.
Le maintien à long terme de la motivation d’une équipe de 60 personnes.
La connaissance des instruments de communication et de persuasion.
La capacité de surmonter des revers et des échecs.
Etre prêt d’aller aux limites de la résistance humaine.
Obtenir les moyens financiers nécessaires.
La persévérance de ne jamais perdre de vue le but, le message.
Le tour du monde est une aventure, une performance de pionniers. Ce travail d’Hercule, Piccard et Borschberg l’ont achevé avec succès. Sur l’étape de la Chine au Japon, André Borschberg était assis dans le cockpit pendant 5 jours, presque sans dormir. L’avion devait être léger, peser le moins possible. Sa construction nécessitait l’emploi de matières nouvelles, jamais expérimentées. Les limites connues de l’ingénierie ont été dépassées. Une performance courageuse des techniciens. Le plus grand revers, les batteries surchauffées et endommagées irréversiblement, a été assumé. Après la pause forcée de dix mois, le décollage réussit pour l’étape suivante du tour du monde, de Hawaii à la Californie. La défaite fut surmontée. L’équipe continua le travail, toujours aussi motivée. Le coût du projet, les 140 millions de francs suisses, fut supporté par des partenaires et donateurs convaincus. C’est ici que le talent de présentateurs des deux pionniers s’est manifesté. On les écoute avec plaisir. Ils sont vraiment convaincants. Ils veulent réellement changer le monde.
Ils veulent changer l’attitude des humains quant à l’utilisation des énergies. Ce sont les précurseurs d’une économie propre. Il s’agit de la façon dont l’humain aborde l’énergie. De nos jours on gaspille beaucoup trop d’énergie. La technologie des moteurs à combustion et des ampoules électriques date d’un siècle. Donc tout-à-fait inefficace. SOLARIMPULS a montré ce que signifie «efficacité énergétique».
Après la fin heureuse du tour du monde un autre instrument a été créé, la «Fédération mondiale pour des technologies propres». Le message est donc suivi de mesures concrètes. C’est la deuxième partie de l’entreprise. La partie la plus importante. Elle s’étend à toutes les fonctions économiques aptes à concilier l’économie avec l’écologie. Cette fédération encourage les actions qui visent l’utilisation durable des ressources et l’amélioration de la qualité de vie. Elle réunit des corporations prestataires d’énergies propres. Enfin, elle les conseille par des solutions concrètes pour la réalisation de l’efficience des énergies.
SOLARIMPULS représente un modèle de la façon dont une idée peut créer une nouvelle industrie par un support publicitaire. Cette mutation vers un avenir meilleur me semble être une bonne performance de l’année 2016. L’idée et sa réalisation d’exploiter plus efficacement les énergies à long terme. Elle continuera d’agir en 2017. Une bonne raison de vous souhaiter une bonne année nouvelle.
Pour cette époque de fête je vous souhaite des heures paisibles de détente, de réflexion et de récupération. Mes meilleurs vœux pour la nouvelle année! Si l’année passée était réussie, réjouissez-vous de la nouvelle. Si elle ne l’était pas, réjouissez-vous d’autant plus.
Bliibud gsund und nämeds nit zschwär! (Restez en bonne santé et ne vous faites pas trop de soucis!)
P-S: Quelle famille, ces Piccards.
Grand-père Auguste Piccard (1884 – 1962) en ballon dans la stratosphère.
Père Jacques Piccard (1922 – 2008) 11.000 mètres sous la mer dans le Bathyscaph.
Fils Bertrand Piccard (* 1. mars 1958) psychiatre, scientifique et aventurier, tours du monde en ballon et avion solaire.
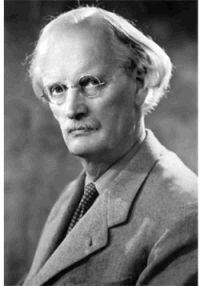 |
 |
 |
Visits: 76



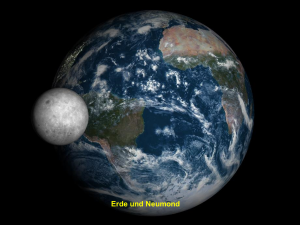
![terre et pleine lune Photo prise Avec le Hubble-Télescope spatial [HST]](https://www.vonwerraleuk.com/wp-content/uploads/2016/10/Erde-drei-300x225.png)