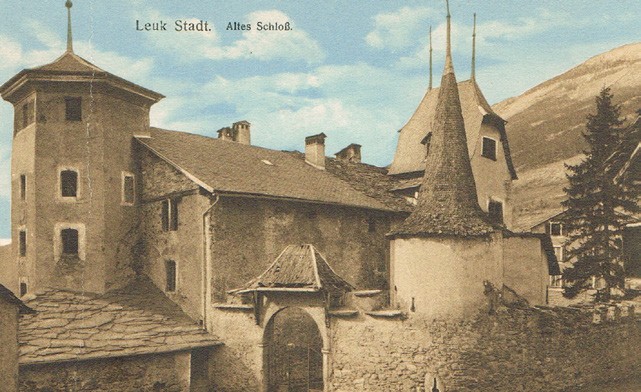1784
Alex war überwältigt. Der Sebastiansplatz in Brig glich einem Termitenhaufen. So viele beschäftigte Menschen an einem Ort hatte der junge Gymnasiast noch nie erlebt. An einem warmen Tag Ende des Sommers hatte Alex Salgesch in der Früh verlassen. Zu Fuss marschierte er nach Brig, um gegen Abend dort anzu- kommen. Zufällig war, als er in Leuk eine kleine Pause machte, Robert Allet mit seinem kleinen Karriol aufgetaucht. Er hatte in Brig zu tun und nahm den Studios mit. So kam Alex viel früher als geplant in der Kollegiumsstadt an.
Er stand noch vor dem Hôtel «Couronne et Poste». Zwei Postillione berei- teten gerade eine Kutsche für eine Reise rottenabwärts vor. Gepäckstücke la- gen ungeordnet herum und versperrten den Passanten den Weg. Aufgeregte Fahrgäste standen um den Rummel herum, darauf wartend, die Diligence end- lich besteigen zu können. Viele gut gekleidete Mägde – in Brig mussten viele wohlhabende Burger wohnen – stritten sich mit den Krämern, um einen guten Kaufpreis zu erkämpfen. Hier würde es Ferdinand gefallen.
Zwei Kuriere zu Pferd bewegten sich in ruhigem Schritt durch die Menschenmenge dem Stadttor zu. Vor den Herbergen sassen Kaufleute vor einem Ballon Weissen und gestikulierten. Ihre Argumente wurden damit optisch hervor- gehoben. Auch die Beinen hatten ihren Part. Heftiges Aufstossen des Fusses sollte die Wirkung erhöhen. Alle sprachen zur gleichen Zeit miteinander und durcheinander. So wurde in Brig Politik gemacht. Alles fand im Freien, vor dem Gasthaus, statt.
Vor vier Jahren war Alex hier angekommen. Inzwischen gehörte er zu den be- standenen Studenten des Kollegiums. Ferdinand war nun auch schon zwei Jah- re in Brig. Während Alex der unbestrittene Primus war, schlug sich der kleine Bruder so recht und schlecht durch den zu lernenden Stoff. Alex bot ihm As- sistenz, damit er nicht aus der Schule gewiesen werden konnte, und half ihm tüchtig bei den Studienausgaben. Es war ein Glück, einen grösseren, begabten, fleissigen Bruder zu haben.
Auch heute traf er zwei Kommilitonen am Brunnen bei der Sebastianskapelle. Es gehörte sich, dass ein echter Student einen speziellen Rufnamen, einen Vul- gonamen, hatte. Sein bester Freund Kilian Kalbermatten wurde Kaka gerufen. Patrice Perrig hatte Peri als Vulgo. Alex wurde mit Lex und Ferdinand mit Ferdi angesprochen. Es gab noch einen Vierten im Bunde, Theobald Tscherrig. Den nannte man Tschix. Heute war er abwesend. Er hatte andere Verpflichtungen. Unter Peris Führung begaben sich die drei zur halb verfallenen Scheune hinter der Herberge «La Poste». Dort sassen sie oft, unsichtbar für die Öffentlich- keit, und rauchten. Wie alle Männer rauchen, rauchten auch sie. Zwar waren sie noch nicht erwachsen, aber immerhin männlichen Geschlechts. Der teure Tabak wurde nicht verraucht. Anstelle der Zigarren der Herren rauchten sie Nielen. Nielen kosteten nichts und wuchsen am Waldrand. Mit dem Sackmes- ser wurden Stängelchen von zwei Zoll Länge geschnitten, angezündet und ge- raucht. Besonders gut schmeckte der Rauch nicht. Nielen waren Zigarren für
arme Studenten. Kaka wusste, dass sie mit dem botanischen Namen «climatis vitalba» und auf gut Deutsch «Waldrebe» hiessen. «Heute ist ein besonderer Tag», vermeldete Peri. «Heute gibt es etwas Besonderes.» Er hatte zu Hause im Rauchzimmer ein paar echte Zigarren stibitzt. Montheyer nannte er sie.
«Erwachsene Männer rauchen keine Nielen. Die rauchen richtigen Tabak, entweder als Zigarre oder in der Pfeife. Heute wollen auch wir als erwachse- ne Männer rauchen», dozierte er und schnitt mit seinem Taschenmesser eine Zigarre in zwei Hälften. Die verteilte er an Kaka und an Ferdi. Er zündete sich eine Ganze an. Vorsichtig zogen sie den Rauch in den Mund. Tatsächlich, das schmeckte weit besser als Nielenrauch. «Die Grossen inhalieren den Rauch», wusste Kaka. «Was heisst inhalieren?» «Den Rauch in die Lunge einatmen. Probiere es.» Das ging völlig daneben.
Ferdi befiel ein grober Hustenanfall. Ihm wurde schwindlig. Beinahe kam das Mittagessen hoch. Er warf den Stummel auf den Boden und stampfte die Glut aus. «Nichts für mich. Dann doch lieber Nielen.» Die zwei anderen pafften munter weiter, mussten sie doch zeigen, dass sie echte Männer waren. Was nicht erwähnt wurde war, dass weder Kaka noch Peri den Tabakrauch inhaliert hatten.
Das Prinzip der Lateinschule benutzte Alex, um Ferdinand zu erklären, wie das im Kollegium läuft. «Alles dreht sich um Latein. Während sechs Jahren wird von Montag bis Samstag eine Stunde Latein unterrichtet. Dazu kommt täglich mindestens eine Studienaufgabe. In der Regel eine Übersetzung aus dem Latein auf Deutsch. Der ganze Stoff ist in drei Blöcken à zwei Jahre gegliedert. Sie werden Grammatik, Rhetorik und Dialektik genannt.» Alex besuchte jetzt die Dialektik, Ferdinand die Rhetorik.
«Das zweitwichtigste Fach ist die Christenlehre. Da geht es um Altes und Neues Testament, Kirchengeschichte, Liturgie und Katechismus. Alle Studis sind selbstverständlich auch Messdiener. Naturkunde, Erdkunde und Mathematik fungieren als Nebenfächer. Im letzten Jahr vor der Matura besucht man noch das Lyceum. Man ist dann Maturand.»
Nach den üblen Erfahrungen des Tabakrauch-Inhalierens hatte Ferdinand seinen Freizeitaufenthalt in den Arkadenhof verlegt. Täglich kamen Säumer vom Simplon nach Brig. Das Kommen und Gehen der Maultiere gehörte zum Stadtbild. Die Warenumschlagzentrale war der Arkadenhof im Stockalperpa- last. Anfänglich hatte sich Alex auf eine der Steinbänke beim Eingang gesetzt und dem Treiben zugeschaut. Was auf den ersten Blick als undurchsichtiges Durcheinander daherkam, zeigte sich bei genauerem Hinschauen als eine gut funktionierende Organisation. Der Chef des Betriebes war Hildebrand von Stockalper, Sohn des Clanchefs Kaspar Jost. Er hatte alles im Griff. Er hatte den Überblick. Er dirigierte das Geschehen.
Ankommende Mulis wurden in die südliche Ecke des Hofes gewiesen. Die Ware, das konnte Wein, wertvolle Textilien oder Salz sein, wurde dort abge- laden und kontrolliert. Knechte führten die müden Tiere zur Tränke und zum Haferplatz. Der Ballenführer und Hildebrand einigten sich über den Zustand und den Wert der transportierten Waren und feilschten um die Transportkos- ten. Wenn man handelseinig war, unterschrieb Hildebrand die Empfangsbestä- tigung. Der Ballenführer holte damit in der Kanzlei im Schloss sein Geld ab. Zurück, nahm er seine gelabten Saumtiere in Empfang und zog mit der Tierschar nach Hause.
Mit der Zeit hatte sich Ferdinand mit den Angestellten angefreundet und half mit, wo er Hand anlegen konnte. Er war gewohnt, mit Pferden umzugehen. Warum nicht auch mit Maulesel? Von der Familie Stockalper war hier aus- ser Hildebrand kaum jemand anzutreffen. Das Gros der Arbeit blieb an den Ballenführern hängen. Zwei Knechte kümmerten sich um die Sauberkeit. Sie fegten den Boden, entfernten den Mist und sorgten für Wasser in der Tränke, für Stroh und Hafer.
Gegen sechs Uhr abends ebbte die Betriebsamkeit ab. Das meiste war erledigt. Oft tauchte dann Rufus auf. Als Haushofmeister und persönlicher Kammerdiener von Kaspar Jodok war er der Chef über das ganze Personal. Ohne sein Wissen lief nichts im Hause Stockalper. Er organisierte die Einkäufe für die Küche, die Arbeit der Stallburschen, jene der Kammerzofen und der Mägde, besorgte den Kurierdienst, beaufsichtigte die Arbeiten in der Kanzlei und verwaltete das Haushaltsgeld. Ferdinand hatte schnell begriffen, dass er der wichtigste Mann im Gesinde war. Mit ihm stand man besser auf gutem Fuss. Es war Rufus nicht entgangen, wie gut Ferdi die anfallende Arbeit in der Karawanserei erkannte und anzupacken pflegte. So kam es, dass Rufus ihn eines Tages nach getaner Arbeit einlud, mit in die Stadt zu kommen, um dort in der «Couron- ne» ein Bier mit ihm zu trinken.
Für Ferdinand war das eine grosse Ehre. Vom Hofhausmeister des grössten Hauses der Stadt eingeladen zu werden, war schon aufregend. Doch was führte Rufus im Schilde? In der Wirtschaft herrschte, wie immer zu dieser Zeit, gröss- te Betriebsamkeit. Es gehörte sich, nach getaner Arbeit vor dem Nachhause- gehen noch ein Glas Weissen zu genehmigen. Für Rufus war sein Tisch beim Eckfenster reserviert. Männiglich hiess den Obersten im Gesinde Stockalpers willkommen. Dieser grüsste freundlich zurück und schüttelte hier und dort eine Hand. Zusammen mit Ferdinand machten sich die beiden Männer am Stammtisch bequem. Ferdinand galt als zurückhaltender Trinker. Ein Glas zur Mahlzeit war selbstverständlich. Ab und zu, wenn es die Gelegenheit bot, ein Bier. Betrunken hatte Ferdinand noch niemand je angetroffen. Rufus hatte die üblichen zwei Bier schon bestellt und setzte gleich zum Gespräch an. Er wollte Ferdi ins Bild setzen. «Worüber wohl?», dachte der Student. Rufus begann da- mit, die ganze Familie Stockalper vorzustellen. Eine ungewöhnliche Vertraut- heit einem jungen Studenten gegenüber. Wo wollte Rufus hinaus? «Ich habe dich längere Zeit beobachtet, wie du bei uns im Hof mithalfst, die Tiere zu ent- lasten. Du kannst zupacken und Hand anlegen. Du siehst die Arbeit. Du hast eine ganz besondere, angenehme Art, mit den Eseln umzugehen. Solche Leute brauche ich in meiner Equipe. Ich würde es schätzen, wenn du vermehrt bei uns als Werkstudent mitarbeiten würdest. Natürlich gegen Bezahlung.» «Sie überraschen mich, Rufus. Ich war zuhause immer schon für den Stall verant- wortlich. So kam es wie von selbst, dass ich im Arkadenhof immer wieder auf- tauchte und dort ein bisschen mithalf. Das Angebot von vorhin habe ich nicht erwartet. Wäre ich nicht im Kollegium, ich würde sofort zuschlagen. Nur, die Matura geht vor.» «Ich habe Nachrichten, die diesen Konflikt lösen könnten. Stockalper hat eine grosse Menge Geld für den Neubau des Kollegiums gestif- tet. Die Bauerei geht nächsten Monat los. Das bedeutet, die Studenten müssen ausserhalb des Internats bei Familien in der Stadt Unterkunft finden. Bei mir ist ein Personalzimmer frei. Du könntest dort hausen. Du hättest damit mehr freie Zeit für andere Arbeit und du wärst die Kontrolle durch den Präfekten los.» Rufus schmunzelte verschwörerisch bei der letzten Bemerkung. «Um Gottes Willen, Rufus, wie kommen Sie an alle diese Informationen?» «Ich will dir erklären, wie das alles hier läuft. Die Zofen der meisten Familien kennen sich und bilden so etwas wie eine verschworene Gesellschaft. Sie tauschen alle Gerüchte und Informationen, die ihnen zu Ohren kommen, gegenseitig aus. Der Umschlageplatz dieses Wissens ist der tägliche Markt. Hier treffen sich die Mädchen, wenn sie beim Einkaufen sind. Ganz ähnlich ist es mit den Kutschern und den Stallknechten. Sie halten sich auf dem Laufenden und bringen die neuesten Nachrichten von ihren Fahrten zurück. Ebenso die Kuriere, die Ballenführer, die Fuhrhalter, die Bauern und die Verkäuferinnen an den Marktständen. Sogar die Kapuziner mit ihrem Bierhandel sind Teil dieses Informationssystems. Die Herrschaften haben keine Ahnung von diesem inoffiziellen Wissensfluss. Und ich als Haushofmeister von Stockalper habe eine besondere Stellung in diesem Geschäft. Jedermann weiss, dass ich für die Organisation und für den Personalbestand des ganzen Haushalts die Verantwortung trage. Wirklich, ohne mich läuft nichts im Hause Stockalper. Darüber hinaus habe ich, bei aller Bescheidenheit, den Ruf, tolerant und verschwiegen zu sein. Ich sammle nur die Informationen. Für die Verbreitung sorgt das Personal. Allen voran die Frauen, die Köchinnen, die Mägde, die Zofen. Unser Volk ist klar ge- trennt. Die Herrschaft ist eine Klasse für sich. Sie betreibt Handel und Politik. Sie hat ihr eigenes Beziehungssystem. Wir, die wir Lohn nehmen, bilden ein zweites Biotop mit eigenen ungeschriebenen Verhaltungsregeln und Gesetzen. Darauf sind wir sehr stolz. Diese Innungen des einfachen Personals haben ihren eigenen Ehrenkodex. Wer die Regeln verletzt oder untreu wird, ist augenblicklich aus dem Kreis ausgeschlossen und findet keine Stelle mehr.»
Das war eine Lektion fürs Leben. Es entstand eine Denkpause, bevor Ferdinand sagte: «Lieber Rufus, ich nehme Ihr Angebot an. Es braucht keine Entlöhnung. Als Gegenleistung wäre ich froh, wenn ich ab und zu die Pferde bewegen könnte. Ich darf nicht aus der Übung kommen. Ein Ausritt pro Woche wäre schön.» «Ferdinand, du bist ein richtiger Geschäftemacher. Einverstanden. Handschlag. Sobald die Sache im Kollegium publik ist, meldest du dich, und ich zeige dir die Kammer.»
Views: 507