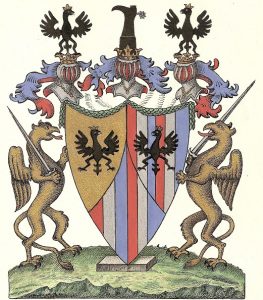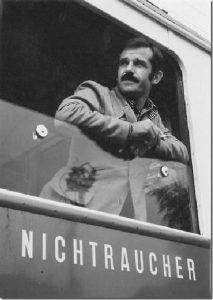Auch mit diesem Blog, liebe Leserin, lieber Leser, komme ich mit einer Geschichte daher, deren Wurzeln in den Achtzigerjahren des letzten Jahrhunderts zurückliegen. Damals ging ich, noch voll im Saft, mit Leib und Seele meiner Arbeit nach. Es war die Zeit, in der der Grosscomputer, unter Fachleuten Mainframe genannt, die Szene beherrschte. Ich war von Anbeginn ab 1970 dabei. Zehn Jahre brauchte es, um das Unternehmen von den herkömmlichen, von Hand durchgeführten Buchhaltungsarbeiten computerreif zu machen. Alles, was bis anhin die Buchhalter und die Arbeitsvorbereiter in ihren Schreibstuben geleistet hatten, übernahm jetzt der Computer. Dachte man. Woran man nicht dachte, war die notwendige Umstellungsarbeit. Die Herkulesarbeit, die es bräuchte, bis der Rechner begriffen hatte, um was es ging. Ganz besonderes Kopfzerbrechen machten die Umstellungen im Materiallager, um in der neuen EDV-Zeit anzukommen. Von den Verkäufern von IBM und Bull & Co. wurde eine neue Welt von Datenverarbeitung, von Zeitgewinn und von Zuverlässigkeit versprochen. Keine Schreibarbeiten mehr, kein Papier mehr, der Grossrechner übernimmt alles. Der Verwaltungsrat schenkte diesem Zukunftssegen Vertrauen. Es wurde ein Mainframe gekauft und installiert. Die Testprogramme liefen wie am Schnürchen. Was für Aussichten! Bessere Ergebnisse, einfachere Überwachung des Betriebs, weniger Personalkosten, mehr Zeit für Innovationen. Alle glaubten ans Paradies auf Erden.
Im Rückblick muss ich an den Zauberlehrling denken. In der bekannten Ballade von Goethe hatte der Zauberlehrling keine Lust, das Bad seines Meisters eimerweise mit Wasser zu füllen. Er verzaubert einen Besen, für ihn die Arbeit zu übernehmen. Als das Bad voll war, konnte er den Besen nicht abstellen. Es kam zur Katastrophe, zur totalen Überschwemmung.
Im übertragenen Sinn ging es in der Unternehmung genau gleich zu und her. „Die Besen, die ich rief…“ ging es dem Verwaltungsrat durch den Kopf. Dass der Betrieb nicht auf die notwendige Umstellung vorbereitet war, konnte man noch verstehen. Dass es aber ein volles Jahrzehnt brauchte, bis nur ein Teil der Versprechungen der Lieferanten in Erfüllung gehen würden, das hatte niemand erwartet. Auch Wunder brauchen ein bisschen Zeit.
Die neunziger Jahre kamen ins Land. An den Grosscomputer hatte man sich gewöhnt. Er wurde nicht mehr mit dem Fluch von Evas Biss in den Apfel im Paradies verglichen. Der Computer erleichterte die Personalbuchhaltung. Der Computer hatte dafür gesorgt, dass im Lager Ordnung herrschte. Nur brauchte man für die Betriebsbuchhaltung mehr Personal, mehr Zeit, mehr organisatorischen Hickhack. Und dazu: auf dem Pult lag mehr Zebrapapier als je zuvor. Zebrapapier deshalb, weil es sich um einen speziellen Ausdruck aus dem Mainframe handelte. Es war ein 40 Zentimeter breites endloses Papierband, aufgewickelt wie man es im Orchestrion kannte. Damit es beim Lesen und Studieren des Inhalts zu keiner Verwechslung der Zeilen kam, wurde abwechselnd eine weisse und eine leicht gräulich unterlegte Zeile als Lesehilfe gedruckt. Gestreift wie ein Zebra. Ein solcher Papierstapel wog gut und gerne anderthalb Kilogramm. Der Inhalt musste von Hand bearbeitet werden. Mühsame Sisyphusarbeit. Es brauchte eine besondere Motivation, die Bemühung in Angriff zu nehmen. So war nun einmal die moderne Art, einen Betrieb zu führen.
Keine Frage, die Firma war zu einem modernen Unternehmen mutiert. Wir hatten einen Mainframe und konnten leidlich damit umgehen. So weit so gut. Nur, wir ertranken im Papier. Wieder waren es die Computerleute von IBM, die, wie sie sagten, eine Lösung parat hatten. Den Personal Computer, den PC. Ich werde jetzt nicht auch noch auf den Leidensweg der Einführung der zweiten Bürorevolution eingehen. Erstens, weil sie liebe Leserin, lieber Leser, inzwischen selbst Besitzerin eines Compi sind. Und täglich einen Kampf mit der Elektronik führen. Ein Kampf, bei dem es meistens keinen Sieger gibt. Wohl aber ein Kampf, der immer und immer wieder zu einem Waffenstillstand führt. Wir haben uns alle hineingeschickt. Ohne PC geht es nicht mehr. Aber einfacher ist das Leben nicht geworden. Und zweitens lasse ich es bleiben, weil die Einführung des PCs zu viele Erinnerungen an die Einführung des Grossrechners aufscheinen lassen würde.
Damit sind wir in der Zukunft angekommen. Ich gehöre nicht mehr so richtig dazu. Natürlich habe auch ich, wie alle Menschen um mich herum, inzwischen ein Smartphone. Die wenigsten von uns sind sich bewusst, dass es sich dabei heute um einen Hochleistungsrechner handelt, besser als jener damals im Apollo 11 Programm. Als Neil Amstrong als erster Mensch auf dem Mond landete.
Wirklich, wir sind im papierlosen Zeitalter angekommen. Es gibt keine Agenda in Büchleinform mehr. Alles im Handy. Es braucht keine Bahnbillette mehr. Alles im Handy. Es braucht kein Bargeld mehr in der Tasche. Das Handy ersetzt die Bankkarte und die Kreditkarte. Alles völlig kontaktlos. Es werden keine Briefe mehr geschrieben. Geht alles per Handy. Es braucht keine Fotoapparate mehr. Handy macht‘s möglich. Telefonieren natürlich mit Handy. Fernsehtelefon (Skype) geht auch per Handy. Kommunizieren mit dem WhatsApp. Machen wir mit dem Handy. Die Uhr auf dem Handy zeigt sekundengenau die Zeit an. Die Taschenlampe ist im Handy immer dabei. Rechtschreibung und Sprache übersetzen geht über Wikipedia und Deepl per Handy. Tageszeitung lesen, natürlich mit dem Handy. YouTube schauen und Mediatheken nutzen, geschieht mit dem Handy. Der Einkaufzettel befindet sich auf dem Handy.
Es gibt noch mehr! Taschenrechner, Adressbuch, Wecker, Erinnerungen, Notizen, Fahrplan und Wetterbericht, überall hilft uns unser Handy.
Kommunikation, Organisation, Informationsbeschaffung mit Suchmaschinen, Videos und Fotos mit eingebauter Kamera, Navigieren mit GPS, Bezahlen ohne Bargeld in der Tasche. Das alles geht ohne Papier.
Und doch.
Es gibt immer noch Zeitungsverträger, Postboten und andere Zustelldienste als Konkurrenz zur Briefpost. Es gibt immer noch Versandkataloge, Bettelbriefe und Wahlkampfplakate. Es gibt eine zahllose Menge von Zeitschriften wie «Der Beobachter» oder die «Schweizer Illustrierte». Es gibt immer noch Kioske an jedem Bahnhof, in jedem Grossverteiler und an jedem Flughafen. Proppenvoll mit Papier. Aus diesem Blickwinkel scheint mir die «papierlose Welt» noch nicht völlig realisiert.
Warum wohl?
Die Schnittstelle von den Augen zum Bildschirm ist das Problem. Immer höre ich «Ich habe gerne, wenn ich lese, ein Buch, eine Zeitung in den Händen. Beim Umblättern knistert es so schön.» Ähnliche Gedanken werden über die Verwendung von Papiertaschenkalender und die Benutzung von Notiz- und Skizzenbücher geäussert. Ein komplizierter Brief lässt sich auf dem Papier besser entwerfen als direkt im PC.
Wir leben in der Zeit der Digitalisierung. Da erscheinen die Vorteile eines papierlosen Büros immer plausibler. Noch ist es nicht erreicht. Der Weg zum papierlosen Büro ist langwierig und bedarf einer gut zu Ende gedachten Vorgehensweise. Es braucht Durchhaltewille. Die meisten, die sich an dieses Projekt wagten, sind auf halbem Wege stecken geblieben. Es ist ein langer Weg. Höchste Konzentration ist verlangt. Der kleinste Fehler in der Software führt zu heftigen Rückschlägen. Viele geben nach halber Arbeit auf. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Einen Weg zurück gibt es nicht. Und der Weg in die Zukunft ist dann verbaut. Es gibt kein zurück. Das System ist derart vernetzt, man findet den Rückweg nicht mehr. Vergleichbar mit einem Bergkletterer, der sich verstiegen hat.
In solch‘ einer Situation wendet sich der Grossvater an seine Enkel und Enkelinnen. Ich habe mich dort umgehört.
Wie ich staunend feststellen konnte, sind sie schon viel weiter unterwegs. Ich erhielt eine mit grösster Selbstverständlichkeit vorgetragene Einführung in diese für mich unbekannte Welt. Erste Voraussetzung sei, dass man im Zehnfingersystem das Keyboard flüssig bedienen könne. Als technische Ausrüstung braucht man einen PC mit Zubehör, ein Mobiltelefon und ein Tablet.
Die Geräte sind unter sich synchronisiert. Ein Vorteil, man kann von überall auf der Welt auf seinen Rechner zugreifen. Und gemütlich Zeitung lesen am Morgen bei einer Tasse Kaffee? Kein Problem. Geht prima mit dem Tablet.
Aus den Gesprächen mit den Enkeln falle ich in die Versuchung, folgenden Lehrsatz abzuleiten: «Je jünger der Jahrgang, umso papierloser sein Umfeld.»
So lernte ich, dass das papierlose Büro schon ziemliche Realität ist. Ganz ohne Papier wird es nie gehen. Papierärmer aber bestimmt.
Visits: 190